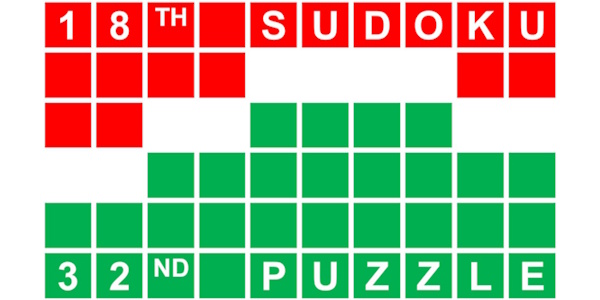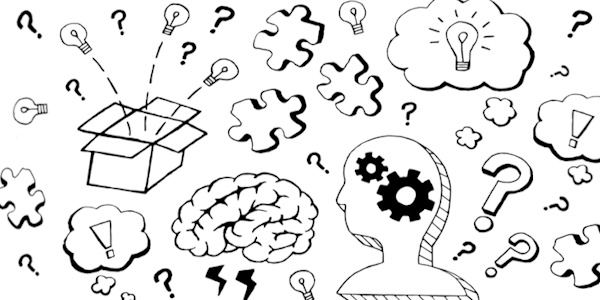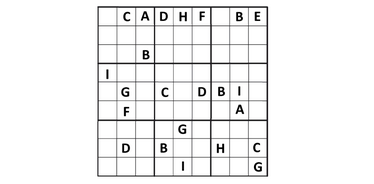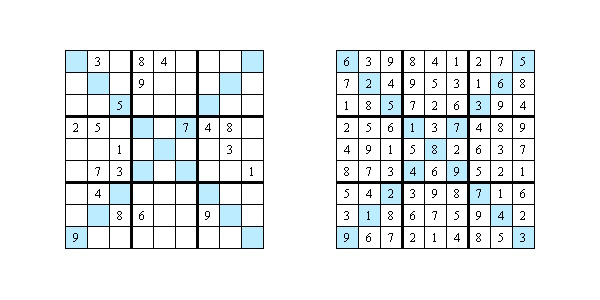Neue Studien zeigen: Das regelmäßige Lösen von Logikrätseln kann nicht nur das Gehirn stimulieren, sondern auch die psychische Gesundheit stärken. Forscher der Universität Oregon (Rahman, Foxman, Markowitz, 2024) analysierten über 30.000 Nutzerbewertungen beliebter Gehirntrainings-Apps, um herauszufinden, welchen Einfluss solche Spiele im Alltag haben.
Die Ergebnisse zeigten: sogenannte „kognitive Spiele“ (darunter Sudoku, Kreuzworträtsel und andere Denksportaufgaben) beeinflussen in erster Linie nicht den Intelligenzgrad, sondern das emotionale Wohlbefinden.
Nutzer, die regelmäßig solche Spiele spielen, berichten:
- weniger Angstzustände;
- mehr Selbstvertrauen;
- ein Gefühl von Ordnung und Kontrolle im Alltag;
- bessere Stimmung.
Einige Studienteilnehmer bezeichneten Sudoku als eine Art Meditation: Das Spiel hilft dabei, sich zu konzentrieren, kurzzeitig abzuschalten und sogar stressige Phasen besser zu überstehen.
Warum funktioniert das?
Menschen sehen Spiele wie Sudoku nicht nur als Gehirntraining, sondern als ein Werkzeug zum emotionalen „Neustart“. Beim Lösen solcher Rätsel hat man eine klare, kontrollierbare Aufgabe mit einem konkreten Ziel – etwas besonders Wertvolles in einer Welt voller Unsicherheit.
Nutzer berichten, dass solche Spiele ihnen helfen, wieder Kontrolle zu erlangen, ihre Gedanken zu ordnen und sich auf etwas Ruhiges zu konzentrieren. Sudoku wird Teil eines täglichen Rituals – manche spielen es morgens vor der Arbeit, andere vor dem Schlafengehen. Es schafft ein Gefühl von Ordnung und Stabilität und hilft, ohne soziale Medien oder Nachrichten zu entspannen.
Die Studienautoren betonen außerdem: Der entscheidende Faktor ist nicht die „Gedächtnisverbesserung“ an sich, sondern wie sich die Person während des Spielens fühlt – fokussiert, ruhig und fähig zu kleinen Erfolgen. Genau diese Empfindungen sind direkt mit dem psychischen Wohlbefinden verbunden.
Darüber hinaus erfordern solche Spiele keinen Wettbewerb, verursachen keinen Stress und stellen keine Erwartungen – man löst die Aufgabe einfach in seinem eigenen Tempo. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern um den inneren Zustand während des Prozesses.